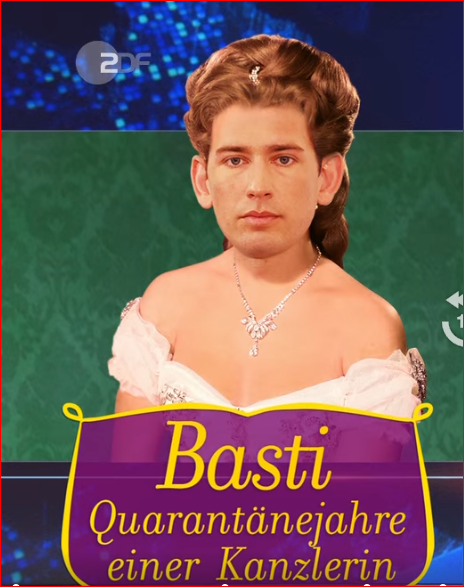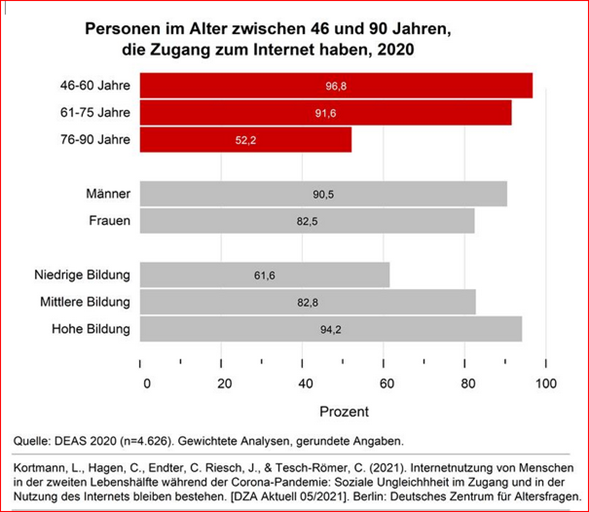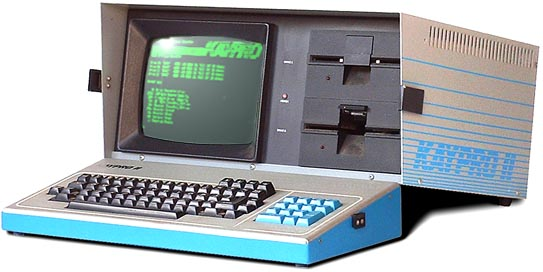Wenn der eingangs zitierte Levi und viele andere das Fallrecht des Common Law als institutionalisierte Analogiebildung erklären, so rufen sie damit die alte Frage nach dem Verhältnis von casus und regula[1] in Erinnerung. Vom Fallrecht des klassischen Rom unterscheidet sich das Common Law dadurch, dass es explizit Präjudizien als verbindlich deklariert. Für das Common Law ist umstritten, ob die Präjudizienbindung durch Analogie oder durch die Übernahme einer im Präjudiz implizit enthaltenen Regel realisiert wird. Anhänger der Regeltheorie[2] nehmen an, dass man einem Präjudiz nur dadurch folgen kann, dass man die ratio decidendi, das holding des Präzedenzfalles, zur Regel abstrahiert und auf den neuen Fall anwendet. Die Analogiker dagegen sehen in der Anwendung eines Präjudizes die unmittelbare Übernahme der Rechtsfolge in einem hinreichend ähnlichen Fall.
Hier noch einmal das Levi-Zitat:
»The basic pattern of legal reasoning is reasoning by example. It is reasoning from case to case. It is a three-step process described by the doctrine of precedent in which a proposition descriptive of the first case is made into a rule of law and then applied to a next similar situation. The steps are these: similarity is seen between cases; next the rule of law inherent in the first case is announced; then the rule of law is made applicable to the second case.« (An Introduction to Legal Reasoning, University of Chicago Law Review 15, 1948, 501-574, S. 501f.)
Sieht man genauer hin, ist die Formulierung ambivalent. Einerseits wird dem Präjudiz eine Regel entnommen, die auf den neuen Fall angewendet wird. Andererseits ist der neue Fall ein »ähnlicher« Fall. Auf Ähnlichkeit kommt es aber nicht mehr an, wenn man eine Regel hat. So ist denn heftig umstritten, ob die Präjudizienbindung nur durch Fallvergleich oder durch die Übernahme einer im Präjudiz implizit enthaltenen Regel realisiert wird. Anhänger der Regeltheorie nehmen an, dass man einem Präjudiz nur dadurch folgen kann, dass man die ratio decidendi, das holding des Präzedenzfalles, zur Regel = Rechtsnorm abstrahiert und auf den neuen Fall anwendet. Mit einer Formulierung von Robert Alexy:
»Die Verwertung eines Präjudizes bedeutet die Verwertung der der präjudiziellen Entscheidung zugrunde liegenden Norm.« [3]
Das ist der Standpunkt der Analogieskeptiker, die keine reine oder originäre Analogie akzeptieren.
Die traditionelle Auffassung geht jedoch dahin, dass ein unmittelbarer Fallvergleich grundsätzlich möglich ist. Prüfstein ist das »nackte« Urteil, das heißt ein Urteil nur mit Tatbestand ohne Begründung. Auch ein »nacktes« Urteil taugt zum Präjudiz. Urteilsgründe braucht man nur, wenn der aktuelle und der Altfall nicht gleich erscheinen. Dann liegt es ähnlich wie bei einem Gesetz, dass sich von seinem Wortlaut her nicht zweifelsfrei anwenden lässt. Dann muss das Gesetz ausgelegt und analog muss das Präjudiz interpretiert werden. Es kommt also darauf an, ob die Fälle gleich oder nur ähnlich sind. Der Analogieskeptiker wird geltend machen: Schlechthin gleiche Fälle gibt es nicht. Keine zwei Objekte sind völlig gleich und ebenso wenig weisen zwei Objekte gar keine Ähnlichkeit auf. Er schließt daraus, dass die Unterscheidung zwischen Gleichheit und Ähnlichkeit beliebig sei und die Analogie als selbständige Argumentation entsprechend wertlos. Analogiker wie z. B. Weinreb erwidern: Die Fähigkeit, Muster zu erkennen, und so zwischen passend und unpassend, gleich und ungleich zu unterscheiden, ist schon bei allen Wirbeltieren vorhanden. Auch beim Menschen ist die Fähigkeit zur Mustererkennung eine angeborene Kompetenz. Sie wird an unendlich vielen Beispielen trainiert und befähigt zur Unterscheidung von gleich, ähnlich und verschieden. Psychologen sprechen vom mappping der zu vergleichenden Situationen. Dem mapping entspricht der Fallvergleich der Jurisprudenz.
Der Fallvergleich ist eine wie selbstverständlich geübte juristische Praxis, die allerdings methodisch wenig reflektiert wird. Daher sei hier noch einmal an die Kontroverse zwischen Fritjof Haft und Arthur Kaufmann erinnert. Für Haft war der Fallvergleich »die zentrale juristische Operation«.[4] Er wandte sich gegen die »Grundvorstellung, daß es dem Rechtsanwender vorgegebene Rechtsideen gebe, und daß diese in abstrakten Begriffen festgehalten werden könnten. … [Denn] Die Gerechtigkeit ist eine Sache des Einzelfalles. Der Einzelfall wird nicht an vorgegebenen Ideen gemessen. Er trägt die richtige Lösung allein in sich« (S. 156f). Über eine »bewußt gestaltete Vergleichsfalltechnik« erfährt man von Haft freilich nicht viel mehr, als dass es sich um »rhetorisches Problem« handelt (S. 160). Auch Arthur Kaufmann sah im Fallvergleich den zentralen Akt der Rechtsgewinnung, nämlich »die Gleichsetzung des zu entscheidenden Falles mit solchen Fällen, die der einschlägigen Norm sicher unterfallen, also eine Analogie«.[5] Der Fallvergleich erfolge im Lichte einer durch Abduktion gewonnenen Normhypothese. Kaufmann wandte sich damit ausdrücklich gegen die Auffassung von Haft, dass ein Fallvergleich ohne Norm oder Regel möglich sei, die als tertium comparationis dient.
Indessen verdient weder die Position Hafts noch diejenige Kaufmanns Zustimmung. Hafts Regelnihilismus ist nicht akzeptabel. Ohne Abstraktionen könnten wir uns nicht durch die Welt bewegen. Es geht immer nur um den Grad der Verallgemeinerung. Kaufmann stützte sich auf einen ungewöhnlich engen Subsumtionsbegriff, so dass er praktisch nicht mehr zwischen gleich und ähnlich, Subsumtion und Analogie unterscheiden konnte. Als subsumierbar unter ein Gesetz akzeptierte Kaufmann nur Zahlbegriffe. Jede andere Anwendung einer Regel fordert nach seiner Auflassung eine »Gleichsetzung«, die er als Analogie einordnete (S. 25). Subsumtion war für Kaufmann gleichbedeutend mit Deduktion. Damit verwendete er den Subsumtionsbegriff in dem engen Sinne, der in der formalen Logik maßgeblich ist. Juristen nutzen den Subsumtionsbegriff aber meistens in einem weiteren Sinne, der eine »kleine« Auslegung einschließt. Kaufmanns enger Subsumtionsbegriff hat einen (zu) weiten Analogiebegriff zur Folge, der die Realität der Musterkennung durch menschliche und künstliche Intelligenz verfehlt. Kognitive Neuroinformatik ist heute imstande, auch komplexe Verkehrssituationen eindeutig zu identifizieren.
Die Differenz zwischen Haft und Kaufmann verschwindet, wenn man den juristischen Begriff der Subsumtion als Kategorisierung im Sinne der kognitiven Psychologie versteht und zwischen gelingender und zweifelhafter Kategorisierung unterscheidet. Auch ohne (externen) Vergleichsmaßstab kann man feststellen, dass zwei Objekte gleich sind. Wäre es anders, gäbe es keine Kategorisierung und damit keine Begriffsbildung. Wenn die Objekte verschieden sind, kann man immer noch Ähnlichkeit konstatieren, wenn einzelne Merkmale übereinstimmen. Die Kategorie als kognitives (internes) Muster ist wohl Vergleichsmaßstab, aber noch keine (Rechts-)Norm. Erst wenn es darum geht, zwei Fälle trotz Verschiedenheit als ähnlich gleichzusetzen, braucht man einen weiteren Vergleichsmaßstab. Dann geht es nicht mehr um Ähnlichkeit an sich (ontische oder phänomenale Ähnlichkeit), sondern um relevante Ähnlichkeit.
Die juristischen Kategorien für Gleichheit liefern die Tatbestandmerkmale einer Norm. Wenn die Kategorisierung = Subsumtion misslingt, weil nicht alle, sondern nur einige Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, geht es nicht länger um Gleichheit, sondern um Gleichsetzung aufgrund von Ähnlichkeit. Die Ungleichsetzung entspricht dem distinguishing im Common Law. Black’s Law Dictionary (5. Aufl. 1979, S. 425) definiert: »To point out an essential difference.« Für Scott Brewer handelt es sich dabei um eine umgekehrte Analogie (disanalogy[6]).
Regeln müssen mit Gattungsbegriffen ausgedrückt werden, die ebensowenig scharf sind wie die kognitiven Muster des Vergleichens. Nicht nur im Alltag unterscheidet man zwischen gleich, ähnlich und verschieden. Auch künstliche Intelligenz kann Muster als gleich identifizieren und ähnliche herausfiltern. Es lässt sich schwerlich bestreiten, dass wir Personen, Gegenstände oder Örtlichkeiten, die wir einmal wahrgenommen haben, auch ohne Anlass wiedererkennen. Das gilt nicht nur für identische, sondern auch für gleiche Objekte unabhängig davon, ob Alltagsbegriffe oder Fachtermini als Kategorien dienen. Schwieriger als der Vergleich von kompakten Objekten ist der Vergleich von komplexeren Situationen, wie ihn der Fallvergleich fordert, der die Heranziehung eines Präjudizes rechtfertigen soll. Auch »Situationen« können nur mit Hilfe von Begriffen = Kategorien beschrieben werden. Situationen lassen sich verhältnismäßig einfach kategorisieren, wenn man nur auf einzelne perzeptiv prominente Merkmale abstellt, z. B. auf die Beteiligten (Mann, Frau, zwei, viele), auf den Streitgegenstand (Geld, Beziehung, Politik) oder den Orts- und Zeitbezug. Solche Kategorisierung dient im Vorfeld des Gerichtsprozesses für die Zuständigkeitsverteilung. Sie ist nicht von vornherein teleologisch, sondern – wenn man so will – ontologisch. Sie könnte auch für statistische Zwecke genutzt werden oder für die Zusammenstellung einer Stichprobe in der Sozialforschung. Aber singuläre Merkmale machen noch keinen »Fall«. Wenn es um den Tatbestand eines Präjudizes geht, wird es insofern schwierig, als der Fall keine schlechthin objektive Einheit bildet. Was als Fall definiert wird, ist ein interessengeleiteter Ausschnitt aus der Welt. In juristischem Zusammenhang erhält der Fall seine Konturen aus vorhandenen oder gewünschten Regeln, aus Urteilstatbeständen und Klagevorbringen. Immerhin ist der Altfall ist abgeschlossen. Man darf nicht mehr nach Umständen fragen, die dem Erstgericht nicht bekannt waren. Dagegen ist der neue Fall noch offen. Man kann immer noch nach ergänzenden Tatbestandselementen suchen, die einen Unterschied machen. Dennoch bleibt ein vorjuristischer, sozusagen ontologischer Fallvergleich möglich. Die Jurisprudenz würde auf ein wichtiges Element ihrer Urteilskraft verzichten, wenn sie sich nicht zutraute, zwischen Gleichheit, Ähnlichkeit und Verschiedenheit zu differenzieren.
Es geht um die Frage, ob ein Gleichheitsurteil möglich ist, ohne dass man den Sinn und Zweck einer Regel bemühen muss. Unser Alltagsrealismus spricht für eine positive Antwort, ist aber wenig beweiskräftig, auch wenn die Epistemologie unter Berufung auf so prominente Autoren wie W. V. Quine einen naturalized turn verzeichnet (o. XXX). Zum Alltagsrealismus tritt der professionell geschulte Realitätssinn hinzu. Dem kann man, wie Brożek[7] und Schauer (S. 88)[8] von vornherein mit Skepsis begegnen. Doch wer mit dem Recht nicht grundsätzlich auf Kritikfuß lebt, wird die Herausbildung von professionellen kognitiven Mustern nicht als Defizit, sondern (mit Weinreb[9]) als Gewinn verbuchen.
»… the choice of which analogy to prefer is not like the flip of a coin. Just as her common sense, the accumulation of ordinary experience, tells Edna that it makes no difference how much cranberry juice costs or whether it is imported, a lawyer or judge relies on his knowledge and experience of law. The greater his experience in the particular area of law, the more likely is it that the analogy he chooses will be convincing to others (just like Edna’s advice [der darin bestand, sie solle den roten Saftflecken mit dem gleichen Mittel bekämpfen wie einen Rotweinflecken], to Mary would be more convincing if Edna had a degree in food chemistry). The choice is informed also by a broad understanding of what is relevant to the sort of decision being made – a matter of liability (Adams) or regulation or business or individual rights – and broader still, what generally ›counts‹ in law.«
Juristische Expertise bietet keine Garantie, aber eine gute Chance, sich bei Vergleichen (beim mapping oder distinguishing) auch Charakteristisches und Relevantes zu konzentrieren und Nebensächliches und Gleichgültiges auszuschalten. Es hilft, sich an die Relationstechnik (Gutachtentechnik) zu erinnern, die der Referendar in der Zivilstation beim Landgericht lernt. Dafür ist ein Tatbestand anzufertigen, der alle potenziell rechtlich relevanten Umstände aufführt, aber auch nur diese. Dagegen kommt es nicht darauf an, ob die Umstände am Ende entscheidungsrelevant sind. Meist fällt es nicht schwer, eine Vielzahl von Umständen für irrelevant zu befinden. Ob der Kläger vor dem Vertragsschluss Rührei oder Müsli gefrühstückt hat ist dann ebenso unerheblich wie seine Haarfarbe.
In vielen Fällen liegt das Gleichheitsurteil auf der Hand. Wurde dem Käufer eines Audi mit Dieselmotor des Baujahrs 2008 Schadensersatz zugebilligt, weil der Motor des Typs EA189 mit einer so genannten Schummel-Software ausgerüstet war, so liegt der Fall des Käufers eines anderen Audi mit diesem Motor, der nunmehr seinerseits Ersatz fordert, gleich. Für das Gleichheitsurteil bedarf es keiner Regel, wiewohl man eine Regel formulieren könnte, die gleiche Fälle dieser Art, und nur diese erfasst. Die Begriffe dieser Regel wären vollständig konstituiert durch ihre frühere Anwendung. In dieser Regel erschöpft sich das holding des Präjudizes.
So klar ist das Gleichheitsurteil nicht immer, aber auch nicht ganz selten. Es gibt viele Standardsituationen. Eine Abtreibung ist eine Abtreibung, ist eine Abtreibung. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Variationen (früh – spät, nach Vergewaltigung, Gesundheitsgefahr für die Mutter, Wahrscheinlichkeit eines kranken Kindes).
Fällt die Kategorisierung von Fällen als gleich »analog« zur Kategorisierung qua Subsumtion zweifelhaft aus, dann allerdings muss ein weiterer Vergleichsmaßstab her. Aber da hilft keine einzelne Regel. Eine Regel deckt entweder nur den Altfall oder nur den Neufall. Für eine Analogie, welche ähnliche Fälle gleichstellt, benötigt man eine Norm, die beide Fälle einschließt. Erst eine weiter gefasste Norm kann herangezogen werden, um die verschiedenen Fälle als hinreichend ähnlich gleichzusetzen. Es stehen also drei Regeln zur Wahl. Dann gilt es zu begründen, welche Regel den Vorzug verdient. Zur Begründung einer Regel dienen in erster Linie ihr Zweck und als Kehrseite ihre Folgen. Damit setzt ein Wechselspiel von Fallvergleich, Regelbildung und Begründung ein. Das nackte holding ist ein theoretischer Grenzfall. Man geht davon aus, dass sich die Richter bei ihrem Urteil etwas gedacht haben, und das fließt bei der »hermeneutischen« Rekonstruktion[10] des Präjudizes ein. Die relevante Ähnlichkeit ergibt sich aus der Begründung der Norm. Aber es bleibt dabei, dass auch der unmittelbare (phänomenologische) Fallvergleich die Wahl der Regel mitbestimmt. Fallvergleich und teleologische Überlegungen wirken zusammen.[11] Die bloße Ähnlichkeit der Fälle gibt Anlass, auf den Zweck der im Präjudiz ausgedrückten Regel zurückzugehen, denn der Zweck kann die Gleichsetzung per Analogie stützen, weil er zeigt, welche Ähnlichkeit relevant ist. Auch wenn man nicht so weit geht, wie Fritjof Haft mit der Ansicht, der Einzefall trage die richtige Lösung allein in sich, so weckt doch der Fall eine starke Intuition, die sich nicht ganz unterdrücken lässt.
[1] Dazu 2015 drei Einträge auf Rsozblog.de: Casus und Regula; Die Hellenismuskontroverse; Das Motto des Freirechts: »Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat«.
[2] Zu diesen zählen u. a. Larry Alexander, Constrained by Precedent, Southern California Law Review 63, 1989, 1-64; Larry Alexander/Emily Sherwin, Demystifying Legal Reasoning, 2008; Ronald M. Dworkin, In Praise of Theory, Arizona State Law Journal 29, 1997, 353-376, S. 371: »An analogy is a way of stating a conclusion, not a way of reaching one, and theory must do the real work.«; Melvin Aron Eisenberg, The Nature of the Common Law, 1988, S. 83f: »Reasoning by analogy differs from reasoning from precedent and principle only in form. … Cases are not determined in the common law simply by comparing similarities and differences.«; Neil MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, 2003 [1978], S. 161, 186; Richard A. Posner, Overcoming Law, 1995, S. 177, 519f; Kent Greenawalt, Law and Objectivity, 1992, S. 200; Peter Westen, On »Confusing Ideas«: Reply, Yale Law Journal 91, 1982, 153-1165, S. 1163: »One can never declare A to be legally similar to B without first formulating the legal rule of treatment by which they are rendered relevantly identical.«; Frederick F. Schauer, Playing by the Rules, A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and Life, 1991; ders., Thinking Like a Lawyer, A New Introduction to Legal Reasoning, 2009 (S. 85ff).
[3] Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, 1978, S. 336.
[4] Fritjof Haft, Falldenken statt Normdenken, Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung (Hg.), Der deutsche Sprachgebrauch, Bd. II, 1981, 153-161, S. 153.
[5] Arthur Kaufmann, Das Verfahren der Rechtsgewinnung – eine rationale Analyse, Deduktion, Induktion, Abduktion, Analogie, Erkenntnis, Dezision, Macht, 1999, S. VI.
[6] Scott Brewer, Exemplary Reasoning: Semantics, Pragmatics, and the Rational Force of Legal Argument by Analogy, Harvard Law Review 109, 1996, 923-1028, S. S. 936, 983, 1006.
[7] Bartosz Brożek, Analogy in Legal Discourse, ARSP 94, 2008, 188-201, S. 193.
[8] Frederick Schauer, Thinking Like a Lawyer. A New Introduction to Legal Reasoning, 2009, S.88.
[9] Lloyd L. Weinreb, Legal Reason. The Use of Analogy in Legal Argument, 2. Aufl., 2016, S. 59f.
[10] Ralf Poscher, The Hermeneutics of Legal Precedent, SSRN 2022, 4042864.
[11] Weinreb S. 60ff.
Ähnliche Themen