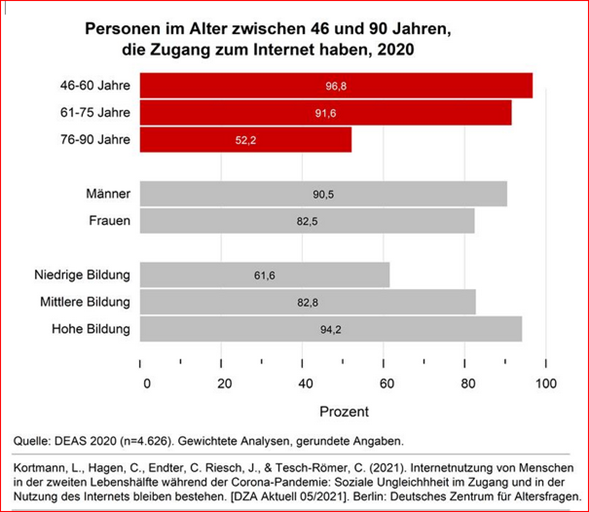Der Digitalisierungsminister hat gerade eine fantastische Neuerung verkündet. Demnächst soll der Kraftfahrzeugschein digital verfügbar sein, so dass er nicht im Fahrzeug mitgeführt werden muss.[1] Auf anderen Gebieten ist die Digitalisierung schon weiter vorangeschritten. Im Prinzip sind die Kommunen heute im Stande, mit Hilfe von Verkehrsüberwachungseinrichtungen (»Blitzer«) automatisch Verwarnungen und Bußgeldbescheide zu erzeugen. Solche Bescheide müssen allerdings immer noch mit der Schneckenpost zugestellt werden. Immerhin bieten die Behörden meistens eine Internetadresse an, wenn man antworten will.
Zahlreich sind die Fälle, in denen dem Betroffenen angeboten wird, eine Verkehrsordnungswidrigkeit durch Zahlung eines Verwarnungsgeldes zu erledigen. Dazu wird die IBAN des Behördenkontos mitgeteilt und man wird aufgefordert, den fraglichen Betrag unter Mitteilung des Aktenzeichens oder eines Kassenzeichens zu übeerweisen. Neuerdings gibt es auch einen QR-Code zur Automatisierung des Online-Bankings.
Nun habe ich wegen einer geringfügigen Geschwindigkeitsübertretung ich eine Verwarnung über 30 EUR erhalten. Wollte ich bezahlen. Das gehört nun einmal zu den Nebenkosten des Autofahrens. Selbstverständlich nutze ich seit vielen Jahren das Online-Banking, allerdings nicht auf dem Handy; das ist mir zu fummelig, und Fachleute sagen, das sei auch zu gefährlich. Deshalb kann ich auch den QR-Code nicht nutzen. Da muss ich nun zunächst die IBAN händisch abschreiben. Das ist schon schlimm genug. Freundliche Gläubiger erleichtern diese Aufgabe, indem sie die IBAN optisch in fünf Vierer-Gruppen und eine Zweier-Gruppe aufteilen. Vier Zeichen kann ich mir für die Übertragung ohne weiteres merken, 22 dagegen kaum. Zudem gibt es für die Eingabe der IBAN einen doppelten Kontrollmechanismus, die Prüfziffer und die Wiedergabe von BIC und Geldinstitut. Den Geldbetrag einzugeben, ist dann kein Problem mehr. Anders steht es um den Verwendungszweck. Die Bank sagt in ihrem Formular, die Angabe sei optional. Da fehlt mir die Motivation, nun noch das Aktenzeichen abzutippen, das aus 15 ohne Abstand gedruckten Ziffern besteht. Da könnte ich zu leicht einen Fehler machen. Einfacher ist, ich gebe das KFZ-Kennzeichen an. Mit Hilfe der Kombination aus Namen, Kennzeichen und Betrag sollte es wohl möglich sein, die Überweisung zuzuordnen. War es aber nicht. Nach drei Wochen wurde das Geld zurücküberwiesen, weil man es nicht habe zuordnen können. Eine Nachfrage gab es nicht. Nun meint die Stadt natürlich, es sei ein Bußgeld fällig, da das Verwarnungsgeld nicht gezahlt worden sei. Ich bin da anderer Meinung. Aber darum geht es nicht. Diese Meinungsverschiedenheit kann ich allein austragen. Vielleicht ist mein Problem auch nur fiktiv. An dieser Stelle geht es mir allgemeiner um das Aktenzeichen als Schnittstelle zwischen Bürger und Bürokratie.
Worum es geht, habe ich im Eintrag vom 8. Februar 2022 skizziert; es geht um die strukturelle Differenz zwischen Individuum und Organisation, und hier konkret um die Kommunikation zwischen Bürger und Bürokratie.
Klar: Die Verwaltungen wollen und müssen effektiv arbeiten. Das geht nicht ohne Digitalisierung. Bislang ist die Digitalisierung allerdings nur partiell gelungen. Eine Bruchstelle ist die Kommunikation zwischen Bürger und Bürokratie. Wenn der Bürger etwas von der Verwaltung will, bleibt ihm oft keine Wahl mehr, als sich aktiv in den digitalen Prozess einzubringen. Wenn umgekehrt die Verwaltung etwas von dem Bürger will, so ist das für letzteren in aller Regel belastend. Er hat keinen Grund, der Verwaltung digital entgegenzukommen. Die Verwaltung muss den automatischen Prozess durch Briefpost unterbrechen und wünscht, mit Hilfe des Aktenzeichens möglichst schnell in den automatischen Prozess zurückzufinden. Dafür hat der Bürger sogar ein gewisses Verständnis, jedenfalls wenn er sich fair behandelt fühlt. Aber davon kann keine Rede sein, wenn die Verwaltungen ihre Geschäfts- und Aktenzeichen ohne Rücksicht auf den Bürger bilden, von dem sie verlangen, dass er diese Zeichen verwendet. Es wäre unsachlich, an dieser Stelle geltend zu machen, dass nicht wenige Bürger es unfair finden, dass die Verwaltung die Verfolgung von Verkehrsübertretungen automatisiert, aus Bürgersicht, in erster Linie, um damit Einnahmen zu erzielen.
Faire Aktenzeichen, das heißt solche, die die Bürger verstehen, leicht erfassen und wiedergeben können – das geht nicht? Das Minimum wäre eine drucktechnische Hervorhebung und Gliederung in Dreier- oder Vierer-Gruppen. Auch die Verwendung von sinnhaften Elementen wie Namensbestandteilen oder Sachbezeichnungen im Aktenzeichen ist denkbar. Dann wüsste auch der Bürger, wenn er später seine Kontoauszüge durchsieht, wofür er überwiesen hat. Der Bürger würde wohl gerne bei der Rationalisierung der Verwaltung kooperieren. Voraussetzung ist, dass die Digitalisierung auch ihm Vorteile bringt.
Der mitdenkende Bürger, der durchaus Verständnis für den Rationalisierungszwang der Verwaltung hat, hofft derweil, dass die Digitalisierung so fortgeschritten ist, dass die Verwaltung sein Anliegen oder seine Überweisung mit Hilfe seines Namens und eines weiteren Stichworts – bei Überweisungen sollte da schon der Betrag ausreichen – durch einen schlichten Suchbefehl auch ohne Aktenzeichen identifizieren kann. Heute müsste die EDV Aktenzeichen eigentlich überflüssig machen.
Zurück zum Ausgangsfall: Für die Erfüllung einer Geldforderung gilt als allgemeiner Rechtsgrundsatz auch jenseits des Bürgerlichen Rechts § 362 BGB. Genau genommen ist die Zahlung durch Banküberweisung die Zahlung an einen Dritten. Die gilt nach § 362 II BGB als Erfüllung, wenn sie mit Einwilligung oder Genehmigung des Gläubigers erfolgt. Grundsätzlich gilt die Mitteilung eines Bankkontos als Einwilligung in diesem Sinne. Nun könnte die Behörde wohl geltend machen, sie habe ihre Einwilligung nur unter der Bedingung erteilt, dass als Verwendungszeck ihr Aktenzeichen mitgeteilt werde. Dann müsste aber wohl ganz allgemein gelten, dass im Geschäftsverkehr Überweisungen nur wirksam sind, wenn der Schuldner den vom Gläubiger gewünschten Verwendungszweck im Überweisungsformular angibt. Auf die Idee ist bisher aber wohl noch niemand gekommen. Dann müsste dazu wohl auch eine bedingungslose alternative Zahlungsmöglichkeit angeboten werden. Ganz interessant, auch noch einmal ins OWIG zu schauen. § 56 II 1 lautet, dass das Verwarnungsgeld »bei der hierfür bezeichneten Stelle oder bei der Post zur Überweisung an diese Stelle« einzuzahlen ist. Dass die Überweisung mit irgendwelchen Aktenzeichen verbunden sein müsste, kann ich dieser Vorschrift nicht entnehmen. Die »bezeichnete Stelle« ist schlicht das angegebene Bankkonto.
[1] § 13 VI Fahrzeug-Zulassungsverordnung – FZV. Vernünftige Leute lassen das Ding ohnehin zu Hause, ebenso den Führerschein.Mein Führerschein ist vom 23. 9. 1955. Ich habe grundsätzlich nur Kopien im Handschuhfach und damit noch nie Probleme gehabt.